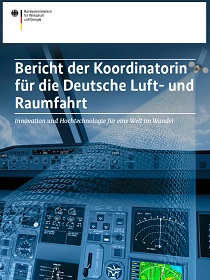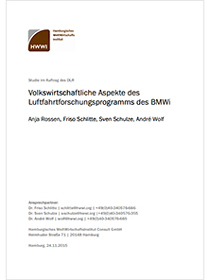Branchenskizze
Die Luft- und Raumfahrtindustrie ist – obwohl eine vergleichsweise kleine industrielle Branche – von enormer strategischer Bedeutung für Deutschland als Hochtechnologiestandort. Sie ist eine tragende Säule der deutschen Wirtschaft und steht für eine hohe industrielle Wertschöpfung und gute Beschäftigung in Deutschland. Kein modernes Flugzeug weltweit fliegt heute ohne Zulieferungen aus Deutschland.
2020 ist der Luftverkehr durch die Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus zeitweise fast vollständig zum Erliegen gekommen, mit Einbrüchen von über -90 % (Juni 2020). Nach Auskunft der International Air Transport Association (IATA) sank der weltweite Flugverkehr im Jahr 2020 aufgrund der globalen Reiserestriktionen im Passagierverkehr um 66%. Der Luftfrachtverkehr konnte sich zwar von der negativen Entwicklung des Passagiergeschäfts entkoppeln, den Rückgang aber bei weitem nicht auffangen.
Auch wenn der Einschnitt in Folge der COVID-19-Krise für die Luftfahrtindustrie am Standort Deutschland tiefgreifend war, so hat sich die Branche insgesamt als resilient erwiesen. Die Hilfsmaßnahmen der Bundesregierung zur Stützung der Branche haben sich als erfolgreich erwiesen (v.a. Kurzarbeit). Inzwischen ist der zivile Passagierflugverkehr insbesondere in der Kurz- und Mittelstrecke wieder auf Erholungskurs – die Rückkehr zum Vor-Corona-Niveau erwartet die IATA aber nicht vor 2024.
Um auch in Zukunft die wirtschaftliche und technologische Stärke sowie die Innovationskraft am Standort Deutschland zu erhalten, ist es für die Bundesregierung wichtig, gezielt in die Technologien und Märkte der Zukunft zu investieren. Dies trifft im Besonderen auf Investitionen zur Dekarbonisierung und Klimaneutralität der Luftfahrt zu, denn: Eine klimaneutrale Luftfahrt bis 2050 ist grundsätzlich möglich.
Hierfür bedarf es aber vieler abgestimmter Maßnahmen, wie:
- Optimierungen wie Leichtbau, Digitalisierung, Aerodynamik, neue Materialien. Allein damit kann der CO2-Ausstoß um bis zu 50% gesenkt werden.
- Kurzfristige Ausweitung der Nutzung von SAF/PtL. Um diesen Schritt zu ermöglichen muss die Verfügbarkeit besser und Preis dieses synthetischen Kerosins niedriger werden.
- Strategische Etablierung alternativer (elektrischer) Antriebssystem auf Wasserstoffbasis. Für die urbane Mobilität (UAM) bieten sich Batterie basierte, für die Kurz- und Mittelstrecke Brennstoffzellen basierte elektrische Antriebe an. Für die Langstrecke werden Turbinen Triebwerke mit einer Wasserstoffdirektverbrennung eine Alternative zu SAF und PTL gesehen. H2-Regionalflugzeug-Demonstrator ist bis 2030 realistisch und zentrales Ziel des Programms BMWK-LuFo Klima.
Dekarbonisierung und Klimaneutralität der Luftfahrt ist auch Bestandteil der europäischen Luftfahrtforschung und -innovation. Mit der ACARE (Advisory Council for Aviation Research and Innovation in Europe) Strategie „Fly the Green Deal“ aus dem Jahr 2022 wurde auf europäischer Ebene ein umfassendes Kompendium und eine anspruchsvolle Grundlage für die Ausrichtung der EU-Luftfahrtforschung erarbeitet. Die vorherigen Leitvisionen von ACARE, „Vision 2020“ von 2001 und „Flightpath 2050“ von 2011, stellten jeweils den zentralen Bezugspunkt für die inhaltliche Ausrichtung der europäischen, aber auch der nationalen Luftfahrtforschung dar.
Die neue Vision beschäftigt sich über die eigentliche Luftfahrtforschung hinaus mit Themen wie Produktentwicklung, Markteinführung, Flugkraftstoffen, Infrastruktur, Digitalisierung und Maßnahmen zur Zielerreichung sowie Synergien. Dabei unterscheidet die Vision zwischen kurzfristigen (bis 2030), mittelfristigen (bis ca. 2035, geplante Einführung des ersten kommerziellen Wasserstoffflugzeug) und langfristigen (2050, klimaneutrale Luftfahrt) Zielen.
Die Raumfahrt liefert neue Erkenntnisse über die Erde und das Weltall, erschließt neue Technikanwendungen, ermöglicht neuartige Dienstleistungen und fördert die internationale Zusammenarbeit.