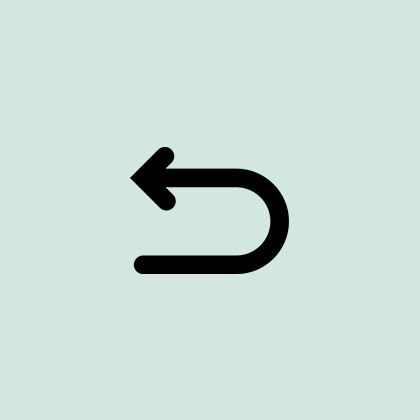Im Finanzsektor fand die Blockchain-Technologie mit der Kryptowährung Bitcoin ihren ersten praktischen Anwendungsfall. Wie eingangs erwähnt, wird durch die Blockchain-Technologie die Herausgabe, Übertragung, Speicherung und der Handel mit digitalen (Wert-)Einheiten (Krypto-Token) ermöglicht.
Die Rechtslage in Deutschland sieht bislang nicht vor, dass zivilrechtliche Wertpapiere auf einer Blockchain begeben werden können. Zu ihrer Entstehung bedarf es der Verkörperung eines Rechts in einer (Papier-)Urkunde. Die Konsultation hat ergeben, dass viele Beteiligte die Tokenisierung von Assets und insbesondere Wertpapieren als eine der zukünftig zentralen Blockchain-Anwendungen ansehen. Mit der Begebung von Wertpapieren auf einer Blockchain könnte – durch Reduzierung der notwendigen Intermediäre – die Durchführung und Abwicklung von Wertpapiergeschäften schneller und kostengünstiger als bislang erfolgen.
Daneben gibt es Token, die zu Anlage- und Finanzierungszwecken eingesetzt werden, aber keine Wertpapiere sind. Im Rahmen der sich seit ca. 2015 mit sogenannten Initial Coin Offerings (ICOs) entwickelnden neuen Blockchain-basierten Finanzierungsform wurden weltweit bisher im wesentlichen Token emittiert, die keine Wertpapiere sind, keine Beteiligungsrechte darstellen und keine Beteiligung an der Unternehmensentwicklung des Emittenten in Form von Zinsen oder Dividenden beinhalteten. Vielmehr erhielten die Anleger in der Mehrzahl bei diesen ICOs sogenannte Utility-Token bzw. Kryptowährungen.
Utility-Token gewähren Zugang zu den vom Projektträger zu entwickelnden digitalen Plattformen, respektive den dort angebotenen Rechten und Dienstleistungen. Dabei steht für viele Anleger nicht der Erwerb der späteren Nutzungsmöglichkeit im Vordergrund, sondern eine erwartete Wertsteigerung des Tokens.
Im Rahmen der Konsultation wurde die Eignung dieser Token zur Finanzierung von Unternehmen und Projekten teilweise in Frage gestellt. Gleichzeitig wurde ein hohes Potenzial für diese Token in den nächsten fünf Jahren gesehen. Als Voraussetzung für eine positive Entwicklung wird die Schaffung eines rechtssicheren, insbesondere auch die Anleger schützenden, Rechtsrahmens gesehen. Dieser soll insbesondere auch Rechtssicherheit darüber schaffen, dass die sich an eine bestimmte Token-Ausgestaltung anknüpfenden Rechtsfolgen klar erkennbar sind.